Impfstoffe, vom US-Verbot bis zu den „Impfgegnern“: Wie Piero Angelas Erben die Wissenschaft wieder in den Mittelpunkt rücken.

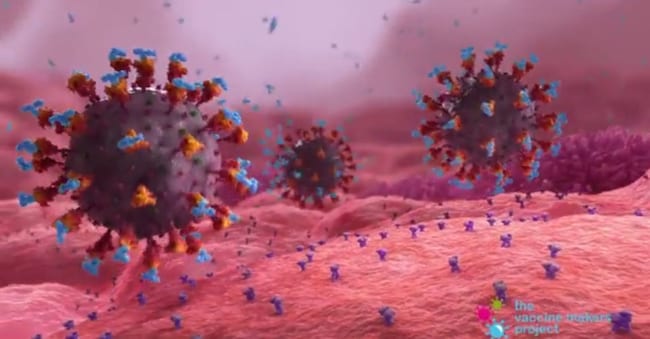
Damals waren Fake News, Verschwörungstheorien oder Pseudowissenschaft noch kein Thema. Doch der große Popularisierer Piero Angela hatte bereits ein Problem auf den Punkt gebracht, das heute hochaktuell ist: Ohne klare Grenzen und Kriterien läuft die Öffentlichkeit Gefahr, mit Informationen konfrontiert zu werden, über die sie nicht mehr entscheiden kann. Ist es wahr oder falsch? Das ist hier die Frage.
Es war im Jahr 1989, und aufgrund dieser Überlegungen beschloss Piero Angela zusammen mit einer Gruppe von „Wissenschaftlern, Intellektuellen und Enthusiasten“, wie sie sich noch heute nennen, die Gründung des CICAP, des italienischen Komitees zur Kontrolle pseudowissenschaftlicher Behauptungen: eine Vereinigung zur sozialen, wissenschaftlichen und pädagogischen Förderung, die die Augen offen hält. Vom Paranormalen über das Ungewöhnliche bis hin zu den „Fälschungen“ derjenigen, die „aus Nachlässigkeit oder Eigeninteresse ungenaue Informationen generieren. Dies ist eines der größten gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir angesichts der enormen Menge an Nachrichten konfrontiert sind, die wir erhalten.“ So die Worte des derzeitigen CICAP-Präsidenten, Professor Lorenzo Montali. Kürzlich äußerte er gegenüber dem gesamten Komitee Bedenken hinsichtlich der Entscheidung von Gesundheitsminister Schillaci, zwei Namen unter die 22 neu ernannten Mitglieder der National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), der Nationalen Technischen Beratungsgruppe für Impfungen, aufzunehmen, die, wie er betont, „im Laufe der Zeit gezeigt haben, dass sie sich nicht auf den aktuellen Konsens in dieser Frage stützen.“ Aus diesem Grund äußert CICAP „starke Zweifel“ am neuen NItag.
Welche Zweifel äußern Sie?
Wir fragen uns, welche Verdienste und wissenschaftliche Expertise im Impfstoffbereich zur Entscheidung geführt haben, Paolo Bellavite und Eugenio Serravalle in diese technische Gruppe des Ministeriums aufzunehmen. Diese Wahl scheint das wissenschaftliche Profil von Nitag nicht zu stärken, sondern im Gegenteil die allgemeine Glaubwürdigkeit seiner Arbeit zu untergraben. Angesichts der Informationsflut aller Art gehen wir davon aus, dass die Entscheidungen zur Auswahl der technischen Gruppen auf expliziten Kriterien der Expertise oder Repräsentativität beruhen können.
Wir befinden uns in einer historischen Phase, in der Impfstoffe und ihr Nutzen stark unter Beschuss geraten: Man denke nur an die Entscheidung der amerikanischen Regierung, die Mittel für mRNA-Impfstoffe zu kürzen, die im Kampf gegen Covid eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Genau: Es gibt ein globales Problem im Zusammenhang mit Impfstoffen. Aber es gibt auch eine konkrete Frage: Wir als zivilgesellschaftliche Vereinigung bitten das Ministerium um die Erläuterung der Kriterien, nach denen im Fall Nitag bestimmte Personen anderen vorgezogen wurden. Während einige – angefangen bei Präsident Roberto Parrella – die Kriterien klar erkennen, geht es um umfassende wissenschaftliche Expertise, andere sind sich nicht sicher, und diese Auswahl muss klargestellt werden. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich um ein Gremium handelt, das die Regierung bei wichtigen Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstützt.
Professor Parrella, der auch Vorsitzender der Italienischen Gesellschaft für Infektions- und Tropenkrankheiten ist, ist sich – um es mit seinen wörtlichen Worten auszudrücken – sicher, dass es mit all den neuen Mitgliedern möglich sein wird, eine nützliche Diskussion und eine fruchtbare Zusammenarbeit aufzubauen, die auf soliden wissenschaftlichen Daten beruht.
In gewisser Weise ist es, als würde man ein Problem eingestehen und gleichzeitig versprechen, es angemessen zu lösen... Der offene Brief, in dem CICAP das Problem anspricht, soll die Gründe für bestimmte Entscheidungen verstehen. Erst wenn diese geklärt sind, kann die Öffentlichkeit ihre Meinung äußern. Die beiden Personen, die wir befragen, haben in ihrem Berufsleben Positionen vertreten, die dem Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft offen widersprechen. Zum Beispiel, indem sie den Zusammenhang zwischen plötzlichem Kindstod und Impfungen unterstützen. Oder sogar, indem sie behaupten, dass COVID-Impfstoffe nicht Millionen von Leben gerettet haben, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft bewiesen hat. Warum sollte man jemanden, der dem wissenschaftlichen Konsens offen widerspricht, in eine Kommission berufen, die sich mit der methodischen Untersuchung von Impfstoffen befasst?
Ist Italien Ihrer Meinung nach in irgendeiner Weise von ausländischen Entscheidungen beeinflusst? Denken Sie an die Haltung des US-Gesundheitsministers Robert Kennedy und seine kühle Haltung gegenüber der Weltgesundheitsorganisation in Bezug auf den Pandemieplan.
Einige versuchen möglicherweise, etablierten Trends zu folgen, wie sie beispielsweise in den USA in diese Richtung gehen. Andere glauben auch, es handele sich um ein „Augenzwinkern“ an einen Teil der Wählerschaft, der sich gegen Impfungen ausspricht. Dafür könnten mehrere Faktoren verantwortlich sein, darunter ein Missverständnis in Bezug auf Ausgewogenheit. Ein Missverständnis, denn im konkreten Fall des NITAG geht es nicht darum, Meinungen einzuholen, sondern ein Gremium zu schaffen, das dem Ministerium dabei helfen kann, methodisch fundierte Entscheidungen zu treffen. Daher ist es wichtig, die kompetentesten Personen einzubeziehen. Wir sprechen von Wissenschaftlern, die hochtechnische Stellungnahmen abgeben müssen. Minister Schillaci selbst ist Arzt und Wissenschaftler: umso mehr, wenn wir ihn bitten, seine Entscheidung zu begründen.
Welche „Stimmung“ zeichnen Sie im Allgemeinen auf?
Der erste Faktor ist Orientierungslosigkeit, die Schwierigkeit, geeignete und zuverlässige Quellen zu finden und somit die Glaubwürdigkeit einer Nachricht einzuschätzen. Es handelt sich also um ein Vertrauensproblem. Der zweite Faktor ist, dass Menschen in der enormen Vielfalt der sozialen Medien auf sehr unterschiedliche Nachrichten stoßen. Die Zahl derjenigen, die sich radikal wissenschaftsfeindlichen, in diesem Fall impfgegnerischen Strömungen, anschließen, ist selbst international relativ gering. Diese radikalen Impfmisstrauen machen 10 bis 15 % der Bevölkerung aus: Das bedeutet, dass 85–90 % ein ausreichendes Vertrauen in die Medizin und die Wissenschaft haben. Diese Minderheit ist jedoch sehr aktiv, gerade weil sie das Bedürfnis verspürt, sich Gehör zu verschaffen, weshalb man den Eindruck gewinnen könnte, dass es viele von ihnen gibt. Demgegenüber gibt es eine Mehrheit der Menschen, die den Hinweisen der Wissenschaft folgen. Schließlich gibt es noch eine dritte Gruppe von „Unsicheren“: ein variabler Prozentsatz, der je nach Situation und Thema bis zu 30 % erreichen kann. Letztere sind Menschen, die sehr empfindlich auf Nachrichten reagieren, gerade weil sie keine klare Position haben und sich deshalb von Zeit zu Zeit unterschiedliche Standpunkte anhören.
Wo stehen wir also in unserem Verhältnis zur Wissenschaft?
Unsere Gesellschaft ist nach wie vor tief in Wissenschaft und Technologie verwurzelt. Doch Tatsache ist, dass einstige Forderungen von Minderheitengruppen wie der Impfgegner-Bewegung nun politische Legitimität erlangen. Der Fall der Trump-Regierung ist international am deutlichsten, und das wirft ein Problem auf: Bürger, die verwirrt und unsicher sind, wie sie mit der Situation umgehen sollen, könnten sich anpassen, wenn sie auf eine politische Autorität treffen, die bestimmte Positionen legitimiert. Wir wissen heute, dass wir nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht vor einem gigantischen Problem stehen: der Glaubwürdigkeit von Informationen und Autoritätsquellen. Deshalb warnen wir vor dem Risiko, dass die Einbindung unqualifizierter Mitglieder in technische Gruppen, wie im Fall von Nitag, die Glaubwürdigkeit der gesamten Operation untergraben könnte.
Neuigkeiten und Einblicke in politische, wirtschaftliche und finanzielle Ereignisse.
Melden Sie sich anilsole24ore



